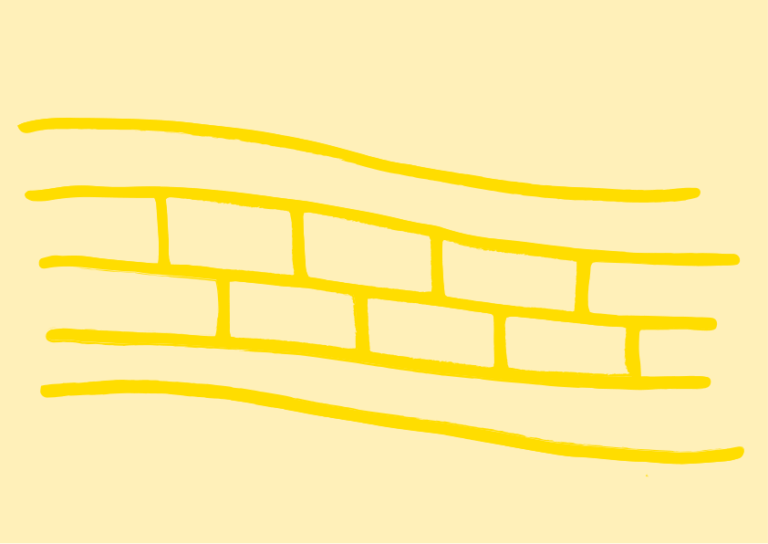Frau Prof. Dr. Fölster-Holst, was ist die S3-Leitlinie „Atopische Dermatitis“?
Generell sind Leitlinien evidenzbasierte und praktische Orientierungs- und Entscheidungshilfen für Ärztinnen und Ärzte zur sicheren und effektiven Diagnose und Therapie von verschieden Krankheitsbildern. Insgesamt gibt es vier unterschiedliche Stufen, eine S1-, S2k-, S2e- und S3-Leitlinie, wobei die höchste Zahl die stärkste Evidenz anzeigt. Somit hat die Leitlinie zur Behandlung der Neurodermitis dementsprechend das höchste Niveau. Sie wurde nicht nur von unabhängigen Expertinnen und Experten anhand von Studienergebnissen und nach ausführlicher Literaturrecherche erstellt, sondern auch durch ein mehrstufiges Konsensverfahren geprüft. Das heißt, dass die in der Leitlinie empfohlenen Präparate und Behandlungsmethoden in langjährigen Studien auf Verträglichkeit, Wirksamkeit und Sicherheit getestet werden. Daher können Betroffene sicher sein, dass die Empfehlungen als sicher einzustufen sind.
Die S3-Leitlinie „Atopische Dermatitis“ wurde im Juni 2023 aktualisiert. Was waren die wichtigsten Updates? Gibt es darüber hinaus seit der Veröffentlichung der S3-Leitlinie noch aktuelle Erneuerungen?
In der Leitlinie werden vor allem lokale (topische) Therapien mit Salben und Cremes (solche, die der Haut Feuchtigkeit und Fette spenden, sowie solche, die Medikamente wie Kortikosteroide oder Calcineurininhibitoren gegen die entzündlichen Prozesse enthalten) sowie systemische Behandlungen mit Tabletten oder Injektionen empfohlen. Bei den Empfehlungen zu den systemischen Therapien gibt es einige Neuerungen in Bezug auf die Behandlung von Kindern und Säuglingen. So ist ein Biologikum nun bereits ab dem sechsten Lebensmonat, ein topischer Calcineurin-Hemmer ab dem 3. Lebensmonat und ein JAK-Inhibitor bei Kindern ab dem 2. Lebensjahr zugelassen.
„Da die Neurodermitis zumeist erstmalig in der frühen Kindheit auftritt, sind Behandlungen mit modernen Medikamenten bei Kindern und Säuglingen auf jeden Fall ein Zugewinn für den Behandlungsalltag. Das Therapieziel „juckreiz- und erscheinungsfreie Haut“ ist damit auch in jungen Jahren realistisch.“
– Prof. Dr. Fölster-Holst
Sie sprechen von modernen Systemtherapeutika wie Biologika und JAK-Inhibitoren. Können Sie laiengerecht erklären, was diese Therapien sind und wie sie wirken?
Ja, sehr gern. Systemtherapien sind, wie der Name schon sagt, Präparate, die auf das ganze System, also den ganzen Körper einwirken. Biologika werden aufgrund ihrer Größe unter die Haut gespritzt. Januskinaseinhibitoren (Hemmer der Januskinase, die eine entscheidende Rolle in der Auslösung der Entzündung haben) werden als Tablette verabreicht Beide Medikamente hemmen wichtige entzündliche Prozesse in der Haut von Neurodermitis-Betroffenen, indem sie im Gegensatz zum Kortison gezielt in den entzündlichen Prozess eingreifen.
Ich finde zur Erklärung des Wirkmechanismus die Schlüssel-Schloss-Analogie sehr anschaulich. Stellen Sie sich vor, hinter einer Haustür wartet eine Entzündung darauf entfacht zu werden. Bei Menschen mit Neurodermitis haben verschiedene Substanzen aus dem Immunsystem einen „Schlüssel“, um diese Tür zu öffnen und somit einen Neurodermitis-Schub auszulösen. Biologika und JAK-Inhibitoren sind „Ersatzschlüssel“, um die Tür zu verschließen. Somit wird eine erneute Entzündungsreaktion unterbunden, da das Schloss bereits „besetzt“ ist.
Tipp der „Bitte berühren“-Redaktion:
Von Anamnese bis Zytokine: Das „Bitte berühren“-Glossar erklärt Fachbegriffe rund um die Neurodermitis einfach und verständlich.
Was raten Sie Eltern von Neurodermitis betroffenen Kindern, die Angst vor systemisch wirkenden Therapien haben?
Ich rate Eltern von Kindern mit schwerer Neurodermitis auch systemische Therapien als Behandlungsoption ernsthaft in Betracht zu ziehen, wenn die Lokalbehandlung nicht zum Erfolg geführt hat. Denn dadurch, dass die Präparate eine sehr lange Testphase auf Verträglichkeit, Sicherheit und Effizienz durchlaufen haben, können sie unbedenklich und sicher eingesetzt werden. Bevor die Medikamente überhaupt bei Kindern und Säuglingen zugelassen werden, werden sie zu Beginn an Erwachsenen und anschließend an Jugendlichen im Alter von 12-17 Jahren getestet. Erst wenn sie sich in diesen Altersgruppen als sicher erweisen, kommen sie bei Kindern und Säuglingen in entsprechenden Studien zum Einsatz.
Welchen Weg sollten Patientinnen und Patienten gehen, um eine moderne Therapiemethode in Anspruch zu nehmen?
Das kommt darauf an, bei wem die Betroffenen aktuell behandelt werden und welcher Schweregrad der Erkrankung vorliegt. Moderne Therapien wie beispielsweise Biologika sind nur für Erwachsene und Jugendliche mit einer mittelschweren bis schweren Neurodermitis zugelassen. Bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis 11 Jahren ist die Indikation lediglich für schwere Formen zugelassen, zudem hat bisher nur ein Biologikum die Zulassung ab dem 3. Lebensmonat erhalten, ein JAK-Inhibitor ist ab dem 2. Lebensjahr zugelassen.
Welcher Schweregrad vorliegt, kann anhand unterschiedlicher Hautscores bei der Dermatologin/Kinderärztin bzw. dem Dermatologen/Kinderarzt festgelegt werden. Dort können Betroffene sich auch zu modernen Behandlungsmethoden beraten lassen. Sollte sich die betreuende Ärztin bzw. der betreuende Arzt nicht mit modernen dermatologischen Therapieansätzen auskennen, ist es ratsam, betroffene Kinder zu einem dermatologischen Zentrum einer Haut- oder Kinderklinik zu überweisen.
In der neuen Leitlinie wird auch vermehrt auf Neurodermitis-Trigger eingegangen. Wie wichtig ist die Identifikation von individuellen Auslösern bei der Behandlung der Erkrankung?
Die Identifizierung von individuellen Neurodermitis-Triggern ist von großer Bedeutung, da sie einen wesentlichen Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung haben können. Da die Neurodermitis zu dem atopischen Formenkreis gehört, kann das Immunsystem von Betroffenen besonders stark auf harmlose Umwelteinflüsse wie beispielsweise Hausstaub, Pollen oder Nahrungsmittel reagieren. Diese Überreaktion führt dazu, dass sich das Hautbild bei den Betroffenen mit Neurodermitis verschlechtert. Da jedoch nur eine Subgruppe der Betroffenen darauf allergisch reagiert (fakultative Triggerfaktoren), ist es wichtig diese Personen zu identifizieren Denn nur so können Allergene vermieden und die Behandlung optimal unterstützt werden.
Wie können Neurodermitis-Trigger identifiziert werden? Was gilt es dabei besonders zu beachten?
Auslöser einer Neurodermitis können auf unterschiedlichen Wegen identifiziert werden. Es kommt darauf an, ob die Allergene über die Nahrung aufgenommen werden oder in der Luft vorzufinden sind. Bei Lebensmittelallergien rate ich Betroffenen und Eltern von Kindern mit Neurodermitis ein Ernährungstagebuch zu führen. Denn Unverträglichkeiten sind manchmal gar nicht so leicht zu erkennen. Deshalb sollen die Betroffenen genau dokumentieren, was zu welcher Tageszeit gegessen wurde. Parallel dazu wird der Hautzustand dokumentiert. Manchmal zeigen sich die Hautreaktionen nicht unmittelbar, sondern erst ein bis zwei Tage nach der Zuführung des Allergens. Sollten Betroffene jedoch eher auf Stoffe aus der Luft wie Pollen oder Hausstaubmilben reagieren, dann sollte ein Prick- oder Reibetest bei der betreuenden Ärztin oder dem betreuenden Arzt durchgeführt werden. Daneben eignen sich Bluttests auf Antikörper (sogenannte Radio-Allergo-Sorbent-Tests (RAST-Tests)), um den Verdacht einer Allergie zu erhärten.
In der heutigen Zeit wird viel von „informierter Entscheidung“ oder „Shared Decision Making“ (SDM) gesprochen. Was genau ist darunter zu verstehen und kann es helfen, den Therapieerfolg positiv zu beeinflussen?
Dieser Therapieansatz sieht vor, dass Patienten und Patientinnen, Betroffene und Ärztin bzw. Arzt sich auf Augenhöhe austauschen und Entscheidungen hinsichtlich der Behandlung gemeinsam treffen. Damit das geschehen kann, müssen die Betroffenen jedoch ausreichend über ihre Erkrankung, die Behandlungsmöglichkeiten sowie über mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt sein. Auch muss die Ärztin bzw. der Arzt auf Einwände gegen bestimmte Behandlungen eingehen und die Wünsche und Ziele der betroffenen Person berücksichtigen. Diese gemeinsamen Termine können besonders zu Beginn sehr zeitintensiv sein, da man in Ruhe die Auswirkungen des Krankheitsbildes und die entsprechenden Therapiemöglichkeiten erklären muss. Am Ende profitieren jedoch beide Parteien gleichermaßen. Für Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel sind die zukünftigen Visiten einfacher und effektiver umzusetzen. Auf der anderen Seite fällt es Betroffenen leichter, sich an den Therapieplan zu halten, da sie den Prozess nachvollziehen können und wissen, dass sie damit ihr Behandlungsziel schneller erreichen können.
Frau Prof. Dr. Fölster-Holst, vielen Dank für das Gespräch.
In deiner Haut steckt niemand geringeres als du selbst, und zwar dein ganzes Leben lang. Umso wichtiger ist es, dass du dich darin so wohl wie möglich fühlst – trotz Neurodermitis. Heute gibt es gute Möglichkeiten, dies zu erreichen. Warum sich also mit weniger zufriedengeben? Sprich mit deiner Hautärztin bzw. deinem Hautarzt!