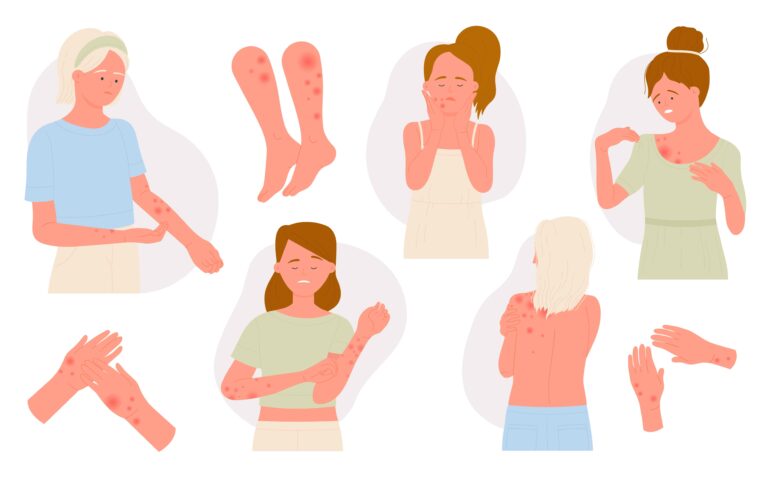Niedrige Behandlungsraten bei Urtikaria
Trotz klarer Empfehlungen erhalten nur 40-60 % der Patientinnen und Patienten eine leitliniengerechte Therapie. Mehr als 30 % bekommen gar keine medikamentöse Behandlung, die ihre Lebensqualität deutlich verbessern könnte.
Die Folgen sind eine hohe Krankheitslast, unnötige Einschränkungen im Alltag und eine erhöhte psychische Belastung. Umso wichtiger ist es, die Erkrankung frühzeitig zu erkennen und konsequent zu behandeln.2
Eine frühzeitige Diagnose und konsequente Behandlung sind daher entscheidend, um die Beschwerden zu lindern und die Lebensqualität wiederherzustellen.
Das kannst du selbst tun:
- Sprich deine Ärztin oder deinen Arzt aktiv auf die Therapieoptionen an.
- Dokumentiere, wann und wie stark deine Symptome auftreten.
- Lenke das Gespräch auch auf psychische Belastungen und Stress – diese können ebenfalls die Symptome beeinflussen. Mehr dazu findest du in diesem Beitrag.
Diagnostik – Schritt-für-Schritt erklärt
Die Diagnostik der chronischen spontanen Urtikaria (CSU) erfolgt bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen und verfolgt dieselben Ziele: eine klare Einordnung der Erkrankung und die Suche nach möglichen Auslösern. Das Diagnoseprinzip ist immer systematisch und patientenorientiert, aber individuell angepasst.1
Folgende Schritte sind nötig, um eine Urtikaria sicher und leitliniengerecht diagnostizieren zu können1:
Schritt 1: Anamnese
Schritt 1: Anamnese
Die Ärztin oder der Arzt beginnt zuallererst mit der Anamnese. Dies ist eine ausführliche Befragung zur gesundheitlichen Situation und der Symptome sowie der körperlichen Untersuchung, der Haut und Schleimhäute. Dabei werden Hautveränderungen wie Quaddeln oder Angioödeme untersucht und dokumentiert. Die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt sollten auch die Fotodokumentation der Betroffenen durchsehen, da die Symptome oft nur kurz sichtbar sind.
Innerhalb der Anamnese erfasst der Arzt oder die Ärztin die Art, Dauer und Häufigkeit der Symptome sowie mögliche Auslöser. Dazu können unter anderem auch bestimmte Medikamente gehören.
Auch Begleiterkrankungen wie Autoimmunerkrankungen, Allergien oder andere atopische Erkrankungen werden berücksichtigt.
Das Ziel dieser ersten Untersuchungsschritte ist die Einordnung in eine akute oder chronische Urtikaria und die Unterscheidung zwischen chronischer spontaner Urtikaria und chronischer induzierter Urtikaria (CIndU).
Mehr Informationen zu möglichen Triggern und Auslöser der Urtikaria findest du hier.
Schritt 2: Erweiterte Diagnostik
Abgrenzung zu anderen Erkrankungen
Nicht jede Hautreaktion mit Quaddeln, Rötungen oder Schwellungen ist automatisch eine Urtikaria. Manche anderen Erkrankungen können ähnliche Symptome verursachen.
Daher ist es wichtig, bei unklaren oder länger anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einzuholen. Nur eine Ärztin oder ein Arzt kann durch gezielte Untersuchungen feststellen, ob es sich tatsächlich um eine Urtikaria handelt oder um eine andere Erkrankung mit ähnlichem Erscheinungsbild – und die passende Behandlung einleiten.
Messinstrumente zur Krankheitsbewertung
Zur objektiven Messung von Krankheitsaktivität und Behandlungserfolg werden spezielle Scores und Fragebögen eingesetzt, die den Verlauf dokumentieren, Therapien vergleichbar machen und eine gezielte Anpassung der Behandlung ermöglichen1:
Urtikaria-Aktivitätsscore (UAS7):
- Misst Symptome: Quaddeln und Juckreiz über 7 Tage (0-42 Punkte).
- Grundlage für Verlaufskontrolle und Therapieanpassung.
- Symptome werden von Betroffenen selbst dokumentiert.
- Es sollte 1 Mal täglich über mehrere Tage dokumentiert werden für eine bessere Einschätzung der Krankheitsaktivität.
Angioödem-Aktivitätsscore (AAS):
- Wird genutzt bei Angioödemen mit oder ohne Quaddeln.
- Bewertet die Häufigkeit, Dauer und Schwere von Schwellungen (0-105 Punkte pro Woche).
Urtikaria-Kontrolltest (UCT):
- Nutzung bei Krankheitskontrolle und Urtikaria-Beurteilung.
- Wird bei Betroffenen eingesetzt, die Quaddeln mit oder ohne Angioödeme haben.
- Besteht aus 4 Fragen zur Krankheitskontrolle, bei dem Werte ab 12 Punkte als „gut kontrolliert“ gelten.
CU-Q2oL und AE-QoL
- Sind spezielle Fragebögen zur Erfassung der Lebensqualität bei CSU und Angioödemen.
- Nutzen ist der messbare Behandlungserfolg.
- Dient einer objektiven Messung der Krankheitsaktivität.
Behandlungsmöglichkeiten bei Urtikaria – Therapie nach Stufenplan
Bei der Behandlung von Urtikaria wird angestrebt, die Symptome bestmöglich zu kontrollieren und die Lebensqualität deutlich zu verbessern – idealerweise ohne Quaddeln, Juckreiz, Angioödeme oder Einschränkungen im Alltag.1
Neben der medikamentösen Therapie ist es wichtig, mögliche Auslöser zu identifizieren und zu vermeiden. Falls die Auslöser nicht oder nur teilweise gemieden werden können, wird empfohlen, eine gewisse Toleranz aufzubauen, wodurch die Krankheitsaktivität verringert wird.
Da die Beschwerden bei Urtikaria in ihrer Stärke schwanken können und sich die Erkrankung in manchen Fällen sogar von selbst zurückbildet, wird empfohlen, alle drei bis sechs Monate zu prüfen, ob die aktuelle medikamentöse Behandlung weiterhin notwendig ist oder angepasst werden sollte.1
Ziel der medikamentösen Therapie ist es, die Symptome in den Griff zu bekommen, sodass eine erscheinungsfreie Haut ein erreichbares Therapieziel ist. Möglichkeiten der medikamentösen Therapie nach dem Stufenmodell1:
Stufe 1:
- Die H1-Antihistaminika der 1. Generation werden aufgrund ihrer möglichen Wechselwirkung und sedierenden Eigenschaft nicht mehr eingesetzt.
- Stattdessen sind H1-Antihistaminika der 2. Generation in Standarddosis die erste Wahl. Sie sind sicherer, wirken kaum oder gar nicht sedierend und eignen sich für die tägliche Einnahme.
- Jedoch erhalten aktuell nicht alle Patientinnen und Patienten moderne Antihistaminika der 2. Generation, obwohl diese oft wirksamer und besser verträglich sind.
- Die Einnahme sollte regelmäßig erfolgen und nicht nur bei Bedarf, um Quaddeln und Angioödeme grundsätzlich zu verhindern.
Stufe 2:
- Wenn die Standarddosis der H1-Antihistaminika bei einer chronischen spontanen Urtikaria nicht ausreicht, kann die Dosis schrittweise bis auf das Vierfache erhöht werden.
- Diese Anwendung erfolgt „off-label“. Das bedeutet: Die höhere Dosierung ist nicht offiziell in der Zulassung des Medikaments vorgesehen, wird aber von den medizinischen Leitlinien empfohlen, wenn die Standarddosis keine ausreichende Wirkung zeigt.
- Die Off-label-Nutzung erfolgt nur nach ausführlicher und vollständiger Patientenaufklärung.
- Wichtig: Verschiedene H1-Antihistaminika sollten nicht gleichzeitig angewendet werden.
Stufe 3:
- Ist die Erkrankung trotz erhöhter Antihistaminika-Dosis noch nicht unter Kontrolle gebracht worden, kann zusätzlich Omalizumab (ein Anti-IgE-Antikörper) eingesetzt werden. Dieses Medikament ist für die Behandlung der chronischen spontanen Urtikaria seit 2013 zugelassen.3
- Die Off-label-Nutzung erfolgt nur nach ausführlicher und vollständiger Patientenaufklärung.
- Wichtig: Verschiedene H1-Antihistaminika sollten nicht gleichzeitig angewendet werden.
Stufe 4:
- Wenn auch Stufe 3 keine ausreichende Wirkung bringt, kann Ciclosporin A zusätzlich zu Antihistaminika eingesetzt werden.
- Ciclosporin A wirkt immunsuppressiv und hat ein mäßiges Sicherheitsprofil, daher wird es nur bei schweren, therapieresistenten Verläufen empfohlen.
- Derzeit ist Ciclosporin A das einzige zugelassene Biologikum für diese Situation.
Arztsuche
Eine Dermatologin oder einen Dermatologen in der Nähe zu finden, der Erfahrung mit der chronischen spontanen Urtikaria hat, ist derzeit nicht einfach.
Es kann hilfreich sein, gezielt nach spezialisierten Urtikaria-Expertinnen und -Experten zu suchen – sogenannte Urtikaria-Zentren nehmen regelmäßig Betroffene auf und bieten moderne, leitliniengerechte Behandlungsoptionen. Eine gute erste Anlaufstelle ist die Arztsuche, die bei der Suche nach geeigneten Dermatologinnen und Dermatologen unterstützen kann.
Abgrenzung zu anderen Erkrankungen
Nicht jede Hautreaktion mit Quaddeln, Rötungen oder Schwellungen ist automatisch eine Urtikaria. Manche anderen Erkrankungen können ähnliche Symptome verursachen.
Daher ist es wichtig, bei unklaren oder länger anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einzuholen. Nur eine Ärztin oder ein Arzt kann durch gezielte Untersuchungen feststellen, ob es sich tatsächlich um eine Urtikaria handelt oder um eine andere Erkrankung mit ähnlichem Erscheinungsbild – und die passende Behandlung einleiten.
Ergänzende Maßnahmen zur medikamentösen Therapie
- Vermeidung individueller Trigger (z. B. NSAR, Kälte oder Wärme).
- Behandlung von Begleiterkrankungen (z. B. Infektionen oder Schilddrüsenerkrankungen).
- Stressmanagement, kann ebenfalls die Krankheitsaktivität reduzieren.
- Ernährungsumstellung bei Verdacht auf Nahrungsmittel-Trigger.
Nicht empfohlen:
- Topische Glukokortikosteroide, die bei vielen allergischen Hauterkrankungen wirksam sind, helfen bei Urtikaria in der Regel nicht – mit Ausnahme einer Druck-Urtikaria an den Fußsohlen, wo sie in Einzelfällen eingesetzt werden können.
- Bei akuter Urtikaria oder einer akuten Verschlechterung der chronischen Form kann eine Kurzzeitbehandlung mit oralen Glukokortikosteroiden (maximal 10 Tage) sinnvoll sein, um die Krankheitsaktivität vorübergehend zu senken.
Kurz und knapp:
- Viele Betroffene erhalten keine optimale Behandlung, obwohl es wirksame Therapien gibt. Das kann zu unnötigen Einschränkungen im Alltag und einer hohen Krankheitslast führen.
- Der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin stellt die Diagnose mit einer ausführlichen Befragung, Blutuntersuchungen und bei Bedarf weiteren Tests, um Auslöser zu finden und andere Erkrankungen auszuschließen.
- Da die Beschwerden schwanken und sich manchmal von selbst bessern, sollte die Krankheitskontrolle alle drei bis sechs Monate überprüft und die Therapie angepasst werden.
- Die Behandlung folgt einem Stufenplan: Beginn mit modernen H1-Antihistaminika der 2. Generation, bei Bedarf Dosiserhöhung (off-label) oder Einsatz von Biologika wie Omalizumab, in schweren Fällen Ciclosporin A.
- Ziel ist eine vollständige Symptomfreiheit und eine normale Lebensqualität.
- Symptomtagebücher und Fragebögen zur Lebensqualität helfen dem Arzt oder der Ärztin, den Verlauf zu beurteilen und die Behandlung optimal anzupassen.
Quellen
- 1 Zuberbier et al. Deutsche S3-Leitlinie zur Klassifikation, Diagnostik und Therapie der Urtikaria, adaptiert von der internationalen S3-Leitlinie, 2022. AWMF-Leitlinienregister (013-028).
- 2 Maurer et al. Unterschiede bei chronischer spontaner Urtikaria zwischen Europa und Mittel-/Südamerika: Ergebnisse der multizentrischen Realwelt-AWARE-Studie. World Allergy Organ J 2018; 11, 32.
- 3 Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft: https://www.akdae.de/arzneimitteltherapie/arzneiverordnung-in-der-praxis/ausgaben-archiv/ausgaben-ab-2015/ausgabe/artikel/2020/2020-03-04/omalizumab-xolairr [zuletzt abgerufen am 10.10.25].